Aufgewachsen in einer christlichen Gemeinde war ich mir über die Wahrheit immer bewusst, die unter dem Namen „Jesus Christus“ gepredigt wird. Vor einigen Jahren hat sich auch mein Herz dafür entschieden, weshalb ich im Geist immer mehr wachsen und im Glauben immer mehr erfahren durfte. Dass Jesus für uns in dieser schlechten Welt nur das Beste will, war mir zu jeder Zeit klar.
Als Realist war ich aber dennoch zu jeder Zeit gefasst, dass das Leben jederzeit mit Schmerz zuschlagen könnte.
Das stetige Wachsen hat dazu geführt, dass ich vom Glauben mehr erfahren wollte, weshalb ich mich an einer evangelischen Bibelschule beworben habe, die drei bis vier Jahre dauern sollte und mit der ich dann im hauptamtlichen Dienst arbeiten kann. Also als Prediger, als organisatorisches Multitalent in Gemeinden oder als beispielsweise Gemeindepädagoge usw.
Die folgenden Seiten und Kapitel erzählen von dieser beschwerlichen Reise und beschreiben, wie sich mein Bild von Gott mit dieser Zeit entwickelt hat. Wie der Titel dieses Berichts vermuten lässt, endet die Geschichte nicht unbedingt mit einem Happy End. Doch das Leben ging schließlich auch weiter. Das Ende dieser Geschichte wird daher nicht das Ende meines Glaubens oder gar meines Lebens sein. Es ist ein Bericht über einen langen, schwierigen Abschnitt.
Ziel dieses Berichts ist lediglich das Erzählen aus einer schwierigen Lebenszeit. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass auch heute noch nicht jede christliche Gemeinschaft für jeden geeignet ist. Dass noch immer christliche, traditionelle Laster bestehen und dass der Weg mit Jesus viel Verantwortung und persönliches Leid mit sich bringen kann.
Was aus den folgenden Seiten welcher Position zuzuordnen ist – also meinen persönlichen Lastern oder denen, der gegenüberliegenden Seite, kann und muss jeder Leser selbstständig entscheiden. Das alles ist eine subjektive Sicht mit Anstrengung zur objektiven Betrachtung. Außerdem ist es gewissermassen ein zusammengewürfelter Text, der sich nicht an Regeln hält; Nicht alle Ereignisse folgen einer linearen Zeitachse. Manchmal mag ich von Vergangenheit sprechen, manchmal von Gegenwart.

Die Vorgeschichte
Eigentlich hat meine Geschichte einen klaren Start und ein ebenso klares Ende. Ist man an diesem Ende aber angelangt, macht es wohlmöglich Sinn, auch die Geschichte vor der Geschichte zu kennen, um sich der Auswirkungen besser bewusst zu werden.
Diese „Vorgeschichte“ beginnt schon etwa zwei Jahre zuvor.
Mein Leben verlief eigentlich selten richtig gradlinig. Konsequent durchgezogen und geschafft habe ich in erster Linie meine Grundausbildung im mechanischen Bereich. Danach ging es beruflich und privat immer wieder mal auf und ab. Besonders privat gelang es mir nur teilweise, eine Lebenssituation zu schaffen, mit der ich vollumfänglich glücklich sein konnte. Besonders viele Konstanten gab es in meinem Leben eigentlich nicht. Etwa meine Großmutter, Mutter und mein bester Freund waren die einzigen Konstanten. Zum Glauben und dem „zugehörigen“ Freundeskreis und der Gemeinde bin ich etwa drei Mal nach einer jeweils zwölfmonatigen Pause wieder zurückgekehrt.
Das alles änderte sich durch ein Ereignis an einem Konflager, bzw. einer Konfirmandenfreizeit. Ebenfalls eine Konstante, der ich trotz aller Launen durchwegs etwa zehn Jahre treu geblieben bin. So habe ich dann zwei Jahre vor der eigentlichen Geschichte Menschen kennengelernt, die mich durch eine beginnende Freundschaft veränderten. Rückblickend muss ich vielleicht eher formulieren: «… die meine Seele durch eine beginnende Freundschaft vervollständigten».
Damit begann für mich mindestens ein Jahr tiefgreifender Veränderungen meiner Ansichten und meiner Persönlichkeit. Vieles davon hat sicherlich auf einer funktionalen Ebene stattgefunden – also ohne, dass ich das bewusst gesteuert hätte. Dennoch habe ich mir einige Ziele gesetzt, von denen manche auch nicht sehr präzise durchdacht waren. Überwiegend konnte ich meine Ziele aber erreichen und meine Persönlichkeit stetig in eine Richtung verändern, mit der ich dann gänzlich zufrieden war. Selbst beruflich war ich sehr zufrieden – ich hatte sozusagen einen glücklichen Lebensabschnitt begonnen. Und das, obwohl ich meinen ewigen Traum vom Tramfahrer noch gar nicht erreicht hatte, sondern im Paket- und Sondertransport tätig war.
Diese Freundschaften hatten zwar eine zeitliche Begrenzung, da diese Menschen nach einiger Zeit in ihre weit entfernte Heimat zurückreisen mussten. Zeitgleich lernte ich aber auch weitere Menschen kennen, aus denen sich Freundschaft entwickelte und die einen prägenden Eindruck hinterließen. Ein paar Monate später bin ich auf eine Frau gestoßen, die heute meine Frau ist und mit der ich ein weiteres glückliches halbes Jahr erleben durfte, bevor die eigentliche Geschichte dann beginnt.
Wie es beginnt
Der Beginn dieser Geschichte ist gleichzeitig Teil der Vorgeschichte. Knapp ein Jahr bevor alles begann begab ich mich in eine Situation außerhalb meiner Komfort-Zone. Ich habe gelernt, dass man das manchmal tun muss, um aus alten Gewohnheiten auszubrechen und bestenfalls neue, gute Erfahrungen zu schaffen, die möglicherweise die Lebenssituation oder Teile davon nachhaltig verändern können. So habe ich mich in meiner Gemeinde für eine mehrtätige Veranstaltung im Zentrum der Schweiz angemeldet, in der es darum ging, neue Horizonte im Glaubensleben zu schaffen. Was da genau auf mich zukommen sollte und wer aus der Gemeinde sonst auch noch dabei sein würde, wusste ich bis dahin noch nicht.
So begann dann eine große christliche Konferenz, mit der ich herausfinden wollte, ob es für mich beruflich so weitergehen soll, wie es derzeit war und wie ich es mir vorgestellt hatte. Mein Interesse an Theologie war groß und so wollte ich mich in diesem Bereich weiterbilden. Diese christliche Konferenz und Messe kam sehr gelegen, da unter anderem viele Institutionen anwesend waren, die über berufliche und private Bildungsgänge informierten und dazu einluden. Ich bat Gott darum, mir in diesen Tagen Klarheit zu geben, wie es denn weitergehen könnte. Schließlich gab es viele Optionen: Die Möglichkeit, privat und geführt Wissen zu erlangen, ein Studium oder eine Ausbildung zu absolvieren, oder auch im hauptamtlichen, christlichen Dienst tätig zu werden.
Nach der Konferenz habe ich zwar einiges über verschiedene Möglichkeiten gelernt, war aber noch nicht in der Lage, eine Entscheidung zu treffen.
Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen.
Matthäus 6, 33
Bibelverse kann man auf viele Weisen interpretieren oder „auslegen“, wie man Interpretation in der Theologie nennt. Dass es keine einzig richtige Interpretation der Bibel gibt, war mir durchaus schon immer bewusst, aber ich habe immer an eine Kern-Wahrheit geglaubt, ohne einzelne Verse wörtlich verstehen zu müssen.
Im Falle von Matthäus 6, 33 ging es mir daher auch so und ich sah mich in vielerlei Hinsicht darin auch bestätigt. Als ich anfing, verschiedene Aspekte meines Lebens diesem Zitat entsprechend zu verändern, bezahlten sich meine Schulden aus älteren Zeiten plötzlich wie von selbst. Grundsätzlich lief es etwa so ab, dass auf unerwartete Rechnungen von in einer bestimmten Höhe ebenso plötzliche Auszahlungen in doppelter Höhe folgten. Und dies nur als Beispiel im finanziellen Aspekt.
Natürlich muss man dazu nicht an einen Gott glauben. Ich denke durchaus, dass dieses Prinzip auch in Form eines Universums, eines Schicksals oder was auch immer funktioniert. Egal, woran man glaubt, ist mir auch klar, dass es trotz allem auch mal Phasen geben kann, in denen man eben nicht gewinnt, sondern Pech hat und verliert. Dieses Bewusstsein ist für das Verständnis der weiteren Geschichte relevant.
Gottes Wort
Einige Monate tat sich nichts in der Frage, wie es im theologischen Bereich weitergehen soll. Ich wollte nicht auf Biegen und Brechen eine Entscheidung treffen. Viel mehr wollte ich das Ganze gut durchdacht angehen. Gottes Wort machte mir bei diesem Plan aber einen Strich durch die Rechnung:
Eines Tages war ich mit meiner Frau (bzw. damals Freundin) und ihrer Freundin an einem Gottesdienst in einer Gemeinde, die ich zuvor noch nicht kannte. Den Inhalt des Gottesdienstes kenne ich heute nicht mehr. Denn ich war zu sehr damit beschäftigt, über etwas kurioses nachzudenken; Plötzlich hörte ich eine Stimme in mir, die mir sagte, dass ich an eine Bibelschule in Deutschland gehen soll. Und zwar eine ganz konkrete, die ich aber nicht benennen möchte. Für mich war das in diesem Moment eine sehr irritierende Situation, da ich wusste, es handelt sich hierbei nicht um einen meiner Gedanken. Da ich ein Mensch vieler Gedanken bin, kenne ich mich in meinem eigenen Kopf ziemlich gut aus. Aber was war es sonst? Zwar kannte ich Menschen und Geschichten, die davon berichteten, Gottes Wort gehört zu haben, aber ich selbst kam noch nie in diesen „Genuss“ und wusste daher weder, wie sich das anfühlt, noch ob es das so wirklich noch gibt.
Nach vielen Stunden und Gedanken war ich mir aber sicher, dass sich hier Gott an mich gewandt hat. Nun war nur noch zu bedenken: Was mache ich jetzt mit dieser Ausgangslage? Es standen verschiedene Optionen offen: Entweder, ich mache mit meinem Beruf weiter, in dem ich mich wohl fühlte und ignorierte somit dieses Zeichen. Eine andere Option war, mich nicht auf die konkret genannte Schule zu bewerben, sondern in meinem nahen Umfeld nach einer Möglichkeit zu suchen. Und die dritte Option, für die ich mich entschieden hatte, war das Folgen des Zeichens und mich bei der genannten Schule zu bewerben.
Falls Schüler oder Dozenten der Schule mir zu den folgenden Seiten etwas sagen möchten, behaltet es bitte für Euch. Denn die Zeilen sind keine Überraschung; das meiste, was hier steht, habe ich bereits in meiner Studienzeit geäußert. Dort war Platz für Dialoge.
Nun denn, ich habe mich für Letzteres entschieden und mich bei der von der Stimme genannten Bibelschule beworben. Oder das hätte ich zumindest so tun können. Denn da ich noch nie von Gott direkt angesprochen wurde, wollte ich von meiner Seite her einen Vertrauensbeweis erbringen und keine Hintertür offen lassen. Natürlich würde man sich im „normalen Leben“ an einem Ort bewerben und bis zu einer Zusage seinen Job nicht kündigen, damit man am Ende nicht ohne Lebenssicherung dasteht. Ich dachte mir aber, dass Gott sich erstens um die Aufnahme an der Schule kümmern würde und zweitens auch um die finanzielle Situation. Schließlich folge ich Gottes Wort und handle hier erstmal nicht aus meiner eigenen Idee und auch nicht nach meinem eigenen Vorteil. Eben nach dem genannten Vorbild von Matthäus 6, 33. So habe ich dann kaum 24 Stunden später bei meinem Arbeitgeber gekündigt und mich dann auf der Bibelschule beworben.
Etwa drei Monate war dann noch nicht klar, ob ich angenommen würde und ob sich die finanzielle Situation klärt. Im ersten Monat nach dieser Aktion hatte ich noch Schulden zu begleichen und staatliche Unterstützung wurde von der Schweiz und von Deutschland nicht ermöglicht.
Ich wurde dann aber letztendlich angenommen und die Schulden konnten abbezahlt werden. Durch meinen derzeitigen Job konnte ich etwa für ein Schuljahr Geld ansparen und mir dadurch Zeit verschaffen, um für weitere finanzielle Lösungen zu sorgen. Doch Gott funktioniert so eigentlich nicht. Ich habe es selbst schon oft erfahren und es auch von Berichten immer wieder gehört, dass Gott eben oft erst dann handelt, wenn es notwendig ist. Im finanziellen Bereich hat sich dieser Grundsatz bis heute so bestätigt. Obwohl ich später enorm hohe und ungeplante Ausgaben hatte, kam ich doch nie in finanzielle Schwierigkeiten. Doch dazu später.
Noch einen Monat
Im September begann meine Ausbildung an der Bibelschule in Deutschland. Etwa einen Monat davor begann eine Reihe von Ereignissen, die alle andeuteten, dass ich auf einen Fehler zusteuerte.
In meinem Job war das eher ein wenig ambivalent. Einerseits wurden die Arbeitsverhältnisse innerhalb eines Monats massiv verschlechtert. So oder so hätte ich mir vermutlich demnächst einen anderen Job gesucht. Gleichzeitig war ich mit den verschlechterten Bedingungen aber nicht immer unzufrieden, sondern ich konnte mich in dem, was ich tat, weitgehend wohlfühlen. Es hätte auch durchaus schlechter sein können und einigen Arbeitskollegen ging es derweil auch nicht besser als mir.
Ein weiterer Problemfaktor war die Kündigung der Wohnung. Einerseits gab es plötzlich Probleme mit meinem damaligen Mitbewohner. Keine ernsten Probleme, wie ich meine. Denn mit einer normalen Lebenssituation hätte man durchaus alles wieder gerade biegen können. Aber durch die erhöhte Arbeitszeit bei meinem Job und vielen zu organisierenden Dingen bezüglich der Ausbildung war dafür keine Zeit und Kraft mehr. Auch der Vermieter hatte Schwierigkeiten gemacht. Zuletzt wollte ich viele Gegenstände loswerden, die ich nicht mehr brauchte. Daher habe ich vieles verschenkt und teilweise verkauft. Was übrig blieb, wollte ich der Heilsarmee übergeben. Am Tag des Auszuges jedoch, an dem ich auch einen Transporter zur Verfügung hatte, ließ diese gegen die Abmachungen einfach zwei Drittel aller Gegenstände zurück, die sie hätte mitnehmen müssen. Ein Desaster, da deswegen viele gute Dinge spontan entsorgt werden mussten. Abnehmer konnte ich bis dahin ja keine finden.
Die ersten Monate
Ich und meine Freundin sind also dort angekommen – einigermaßen ausgeruht, da wir etwa eine Woche noch Ferien, bzw. Urlaub hatten. Die ersten paar Tage dienten dem Ankommen und den Informationen, bevor wir dann richtig unterrichtet wurden. Ich konnte mir bis dahin weder den Betrieb eines richtigen Studiums, noch der dieser Schule richtig vorstellen, auch wenn ich mir die Schule ein halbes Jahr zuvor gut angesehen hatte. Darum blieb ich lange Zeit offen dafür, wie die Strukturen gestaltet sind und auch offen für persönliche Entwicklungen und Leistungssteigerungen. Diese Offenheit war enorm wichtig, denn noch in der ersten Woche begannen erste Ungereimtheiten, die mich und auch manche meiner Mitschüler belasteten.
Gott, ich denke, dieses Mal geht es nicht ohne Dich. Wenn administrative Dinge schief gehen, dann ist es halt so. Aber hier geht es um wichtigeres. Deswegen musst Du mir bitte zur Seite stehen.
Ich habe Angst, dass es häufiger schlimme Momente, wie dieser von heute, geben könnte. Hilf mir dabei!
Tagebuch; einen Tag nach dem Ankommen.
Die Schule nutzt viele Gelegenheiten, um Feiern zu können. Das Feiern muss aber natürlich auch vorbereitet werden. Natürlich aufgrund hoher Gästezahlen, aber auch Feste und Feiern nur unter uns mussten geplant und vorbereitet werden, da wir im Haus ja einige Dutzend Menschen waren. Diese Arbeiten mussten immer die Schüler übernehmen. Viele Aufgaben hingen an den Schülern des ersten Jahres. Schon in der Einführung sagte uns unser Dozent, dass man im ersten Jahr noch nichts verändern sollte, sondern nur beobachten. Ab dem zweiten Jahr könne man dann Dinge in die Hand nehmen. Und so wurde das auch gelebt. Die Schüler des ersten Jahres waren schon für die allererste Feier am ersten Sonntagabend zuständig, mussten für das Schneeräumen um sechs Uhr morgens antreten und hatten von ihren Ferien weit weniger als die anderen, da der Unterhalt des Hauses ja auch in den Ferien bestritten werden muss. Doch zu einigem dazu komme ich bestimmt auch noch später.
Die allererste Feier diente der Begrüßung aller Schüler und Dozenten. Die zweite Feier wartete schon eine Woche später auf uns, forderte ebenfalls Vorbereitung und diente ebenfalls dem Kennenlernen der neuen Schüler. Der Unterschied dieser zweiten Feier war jedoch, dass wir nun bereits mit Unterricht begonnen haben.
Diese erste Unterrichtswoche war eine von vielen Wochen, an denen in mir Verzweiflung ausgebrochen war. Wir mussten ein fremdsprachiges Alphabet und erste Regeln einer Fremdsprache lernen und hatten dafür je zwei Tage Zeit. In anderen Fächern war das Lesen eines ganzen Evangeliums Teil der Hausaufgabe und parallel eben Vorbereitungen zur zweiten Feier. In derselben Woche mussten Lieder und Noten für ein wöchentlich stattfindendes Nachtgebet einstudiert werden, man wurde in eine Bibliothek eingeführt und es fanden Besprechungen statt zu einem großen, mehrwöchigen Event, das schon bald stattfinden würde.
Rund herum hatten wir täglich vier Stunden Unterricht. Manche dieser Aufgaben mussten wir in den Pausen erledigen. Nicht alle, aber einige. Darunter ich. Generell musste ich feststellen, dass Arbeiten in den Pausen, an freien Tagen und Sonntagen nicht nur völlig normal waren, sondern auch subtil und unausgesprochen vorausgesetzt wurden. Ausgesprochen haben das nur die wenigsten – dazu aber später. Wir sind ja noch in den ersten Monaten.
Täglich vier Stunden Unterricht sind eigentlich nicht viel. Da bliebe noch Zeit, um die oben genannten Dinge zu erledigen. Da wir aber täglich gemeinsam zu Mittag gegessen haben, verlor ich also hier schon mal eine ganze Stunde Zeit. An einem Nachmittag der Woche folgte das Arbeiten für den Unterhalt des Hauses, das etwa zweieinhalb Stunden in Anspruch nahm. An einem Tag der Woche war noch eine zusätzliche Stunde Arbeit für ebenfalls den Hausunterhalt fällig und an einem weiteren Nachmittag fielen noch zwei Stunden zusätzlicher Unterricht an.
Auch an den Abenden hatte ich dann selten Frei- oder Lernzeit; an einigen davon stand ein ebenfalls verpflichtendes Abendessen statt, einmal die Woche ging eine Stunde für einen Gottesdienst weg und ebenfalls einmal die Woche rund zwei Stunden für einen weiteren Gottesdienst. Zusätzlich zwei Mal die Woche traf sich die Klasse zum Austausch oder organisatorischen Besprechungen, was ebenfalls eine bis zwei Stunden in Anspruch genommen hat.
So sah meine Standard-Woche aus und darum geriet ich schon zu Beginn in Schwierigkeiten, wobei ich mich enorm angestrengt habe und die Herausforderungen irgendwie noch alle schaffen konnte. Für eine Beziehung oder auch für Kontakte zu meinen Freunden oder Familie blieb überhaupt keine Zeit. Aber ich war der Meinung, dass ich das mit guter Planung und viel Einsatz mit der Zeit noch hinkriegen werde.
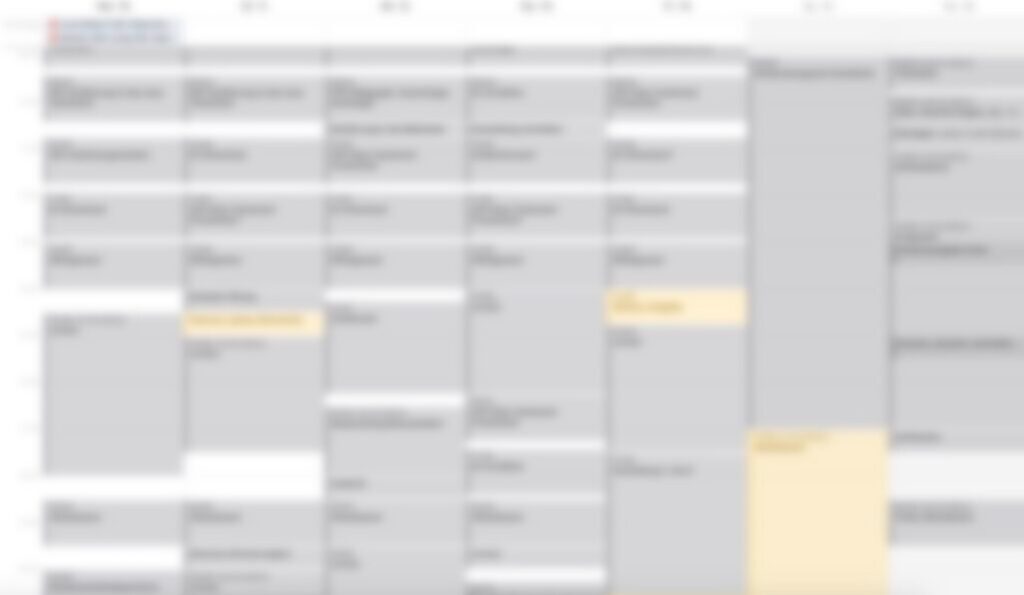
Dieses Bild zeigt eine halbwegs gewöhnliche Woche. Wobei sich hier kaum Termine überlappen. Mit der Zeit musste ich immer häufiger mehrere Termine gleichzeitig wahrnehmen oder Aufgaben während der Unterrichtszeit übernehmen. Die gelben Bereiche zeigen, wie viel Zeit ich für meine Freundin reservieren konnte, wobei zwei dieser drei Bereiche für gemeinsame Hausaufgaben aufgewendet wurden. Aus schon erwähntem Grund möchte ich den Kalender ebenfalls nicht im Klartext zeigen.
Ich bin froh, dass ich noch lebe*. Auf uns kommen viele Herausforderungen zu, aber Gott selbst war es, der mich hier hin geführt hat. Aber es ist nach drei Wochen der härtesten Herausforderungen gut zu wissen, dass meine Beziehung keinen Schaden nehmen kann.
Dass ich das Lernen irgendwie hinbekommen werde, habe ich mir schon im Voraus gedacht. Aber dass es gleich so hart wird, hat uns alle überrascht.
Tagebuch – Drei Wochen nach dem Ankommen.
*Dieser Satz bezieht sich nicht auf eine tatsächliche Lebensgefahr, sondern ist eine Redewendung.
Nach den ersten vier Wochen verließen alle Schüler das Haus, um in verschiedenen Gebieten zweieinhalb Wochen Prospekte der Schule zu verteilen und nach Spenden zu fragen. In Teams gruppiert übernahmen wir viele Dienste der Gemeinde, etwa Jugendkreise, Jungscharstunden, Gottesdienste, Bibelstunden und einiges mehr. Das musste natürlich alles während der vier Wochen zuvor vorbereitet werden. Dazu erhielten wir tatsächlich etwas Zeit im Unterricht. Im Vergleich zum tatsächlich anfallenden Aufwand war es aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Man stelle sich vor, dass junge Erwachsene, die sich noch nicht einmal mit den Gegebenheiten der Schule richtig auskennen, in völlig fremde Gebiete geschickt werden und dort Dinge erledigen müssen, von denen sie keine Ahnung haben. Da ich aber, wie erwähnt, offen für Erkenntnisse war, dachte ich, dass sich das Ungewisse bestimmt auflösen wird, wenn wir erst einmal dort sind. Davon aber keine Spur. Wir mussten zweieinhalb Wochen von Termin zu Termin und von Tür zu Tür rennen und wurden zuvor von den Dozenten angehalten, das Schulische beiseite zu lassen und nicht daran zu denken. Das habe ich natürlich versucht, doch nach vier Wochen intensivem Lernen ist es schwierig, das Lernen plötzlich gänzlich einzustellen und dann zu erwarten, dass das Wissen danach noch im gleichen Maße vorhanden ist. Es musste dann natürlich so kommen, dass ich nach dieser Zeit vieles Wissen wieder aufholen musste.
Nun waren wir zwei Wochen unterwegs. Obwohl es eigentlich eine schöne Zeit war, hat sie dennoch zu unserem Leid direkt und indirekt beigetragen.
Tagebuch – Acht Wochen nach dem Ankommen.
Der Wahrheit gemäß muss ich wohl erwähnen, dass nicht alle in diesen zweieinhalb Wochen so stark unter Strom standen. Ich hatte eine vergleichsweise ruhige Region und konnte dadurch anderen Regionen aushelfen. Ich weiß aber genau, wie es anderen Regionen erging und halte das sogar für absolut fahrläßig. Mittlerweile sind es also nun fast sieben Wochen, in denen wir gearbeitet haben – in welcher Form auch immer. Einige von uns ohne freie Sonntage und dann sollten wir in den fremden Regionen auch noch mit Fahrzeugen unterwegs sein. Ein Wunder, dass es keine Unfälle gab. Die meisten der Schüler sind aber sehr jung, daher war das Energieaufkommen natürlich auch ziemlich groß.
Generell ist zu sagen, dass gut die Hälfte der Schüler mit allen Gegebenheiten gut zurecht kamen, auch wenn sie ähnlich viel, andere aber auch noch mehr investieren mussten, wie ich. Ein Viertel der Schüler hatte kaum Mühe, Aufgaben zu bewältigen, ein weiteres Viertel hatte ebenfalls große Mühe und das entweder zum Ausdruck gebracht, oder auch nicht.
Nach diesen sieben Wochen folgten sechs Tage Ferien, in denen ich das Vergessene wieder nachlernen konnte. Trotz allen Schwierigkeiten in diesen Auswärts-Wochen konnten neue Kontakte entstehen, die dann immerhin für die Zeit an der Schule angehalten und immer wieder positiv auf mich eingewirkt haben. Mit dieser Zeit habe ich angefangen zu verstehen, wie wichtig kleine, aber positive Momente sind, die ich mit anderen Menschen erleben konnte. Kontakte zu Freunden und der Familie in der Heimat hielten dennoch kaum an, was die Kontakte vor Ort um so wichtiger machte.
Das erste Jahr
Die Wochen vergingen nach und nach. Dominiert von Lernstress und Verzweiflung. Trotz allem und der fehlenden Zeit habe ich kontinuierlich versucht, mich in der Gemeinschaft einzubringen.
Vater, ich sehe Dich nicht. Ich kann mir nicht ausmalen, wie schwer es andere Menschen mit ihren Leiden haben und doch habe ich das Gefühl, meiner Anfechtung zu erliegen. Du hast gehandelt und in meinen Alltag eingegriffen und jetzt sitze ich da und frage mich, ob ich an meinem Glauben zweifeln sollte.
Eigentlich ist es ja schade, dass mehr schief läuft, als gut. Ich bitte dich, dass ich schulisch gut mitkommen kann, damit ich dadurch keinen Druck erleiden muss. Ich bitte dich, dass meine Motivation zum Lernen nicht schwindet und mich der Schulstoff mit dir verbindet. Ich bitte dich, dass ich keinen Stress mehr haben werde, der mich bis an mein Limit auslastet. Ich bitte dich, dass ich Zeit für Schule und Gemeinschaft haben kann.
Tagebuch – Der dritte Monat.
Immer mehr füllen sich die Seiten meines Tagebuchs mit flehenden Hilferufen. Doch nichts passiert. Diese zwei Absätze sind gerade mal der Anfang und die Geringsten aller Rufe.
Die Wochen vergehen und das Kalenderjahr neigt sich dem Ende zu. Um einen Gesamtüberblick wahren zu können, lese ich nicht nur meine Seiten des Tagebuchs und verlasse mich nicht nur auf meine Gedanken, sondern blättere auch meinen Kalender durch. Eine Herausforderung, denn die Kalender- sowie Monatsansicht kann diese Fluten von Terminen nicht fassen, sodass sie auf meinem Bildschirm Platz finden würden.
Ein Termin sticht aber heraus: Das freie Wochenende. Man sagt, es startet ab Freitag Nachmittag, sodass man bis und einschließlich Sonntag seine freie Zeit genießen kann. Soweit die Theorie. Nun ist es aber so, dass die Dozenten im Schnitt eine Stunde Nacharbeit pro Stunde Unterricht vorschlagen. Betrachtet man diese Aussage isoliert, geht das am Ende auf, da manche Unterrichtsstunden faktisch gar keine Nacharbeit erfordern und andere dafür zwei oder mehr Stunden. Betrachtet man die Aussage im Kontext wird nun aber auffällig, dass die Nacharbeit nicht mit allen anderen verpflichtenden Aufgaben vereinbar ist, denn der Tag stößt hier schlicht und einfach an seine Grenze von 24 Stunden.
Ich habe das Problem pragmatisch gelöst und mich von meinem Wecker um 05:00 Uhr wecken lassen. So hatte ich vor dem Tagesstart noch Zeit, um zu lernen, oder mich ggf. auszuruhen. Da ich aber selten vor 23:00 Uhr mein Bett aufsuchen konnte, hielt diese Praxis nur ein paar Wochen an, da ich danach zu erschöpft war.
Diese Investition galt selbstverständlich auch für das eben erwähnte freie Wochenende. Zwar waren nur wenige wirklich gezwungen, auch an freien Tagen, Ferien oder an Sonntagen zu lernen, doch ob Zwang oder nicht: In aller Regel traf man immer Leute in der Hauseigenen Bibliothek an, die gerade lernten. Egal zu welcher Zeit und egal an welchem Tag.
Die Dozenten kommunizieren zwar durchaus den Sonntag als Tag des Herrn, an dem man nicht arbeiten müsste, aber mit der Zeit wurde mir klar, dass das eigentlich nur eine Illusion ist. Ungeachtet dessen, ob ein Mensch, bzw. Schüler damit einverstanden ist, oder nicht, soll mindestens ein Tag der Woche als frei gelten und von jeglichen Verpflichtungen befreit sein. Aber auch die Mitarbeitenden der Schule arbeiteten in der Regel durchgehend die ganze Woche.
Die jeweils Erste der drei Klassen kommt zudem eigentlich nur selten in den Genuss von freien Tagen. Wie erwähnt ist die Erste in den Ferien zuständig für den Hausunterhalt. Damit ist ein Schüler zwar nicht den ganzen Tag beschäftigt, vorgesehen wären in der Theorie aber tatsächlich acht Stunden Arbeit. Entweder man hat Pech und arbeitet, weil Arbeit da ist, oder man hat Glück und kann sich auf einer Stunde Arbeit täglich ausruhen. Auch hier war echtes Ausruhen kaum möglich, da auch die Tür geöffnet werden muss, wenn beispielsweise ein Postbote oder einer von drei bis vier Paketdiensten klingelte. Je nach dem, wie groß eine Klasse ist, muss man eben im ersten Jahr öfter ran, oder eben weniger oft. Glück haben sozusagen jeweils diejenigen, die dem ersten Jahr erliegen und mittendrin aufhören. Pech haben die, die das dann ausgleichen müssen.
Nun ist es bald Dezember. Ich komme in den Genuss, zum Geschirr spülen eingetragen zu sein. Wieder einmal ist das isoliert betrachtet kein Thema, schließlich leuchtet es jedem ein, dass nicht für jede erdenkliche Aufgabe Personal eingestellt werden kann. Leider geht aber von der nicht existenten Zeit, bzw. von den kleinen weissen Lücken im Terminplaner dadurch viel verloren. Eine weitere Dauerbelastung, die eine ganze Woche lang durchgehalten werden muss – auch hier einschließlich Sonntags. Ebenfalls im selben Monat kam ich in die Pflicht eines Klassendienstes, in dem eine Woche lang verschiedenste Aufgaben übernommen werden mussten. In dieser Intensität ist es leider nur die erste Klasse, die diesen Dienst tun muss. Bei den beiden Klassen darüber läuft das sehr human. Da geht es darum, dass man als erster aufsteht und als letzter in sein Zimmer gehen kann, weil jemand Tore des Grundstücks öffnen und schließen, Licht einschalten und ausschalten muss und einiges mehr, was dann über den Tag verteilt anfällt. Mit etwas „Glück“ fällt dann diese Aufgabe auch zusammen mit dem Spülen. Natürlich fände man jemanden, mit dem man tauschen könnte. Aber die Praxis hat gezeigt, dass es immer dieselben sind, die sich für freiwilligen Mehraufwand melden und auf Dauer ist das nicht gerecht, auch wenn es für die betroffenen Personen in Ordnung ist. So habe zumindest ich das Tauschen in der Regel unterlassen.
Kurz vor den Weihnachtsferien habe ich irgendwie die Prüfungen bestanden. Angesichts meiner Investitionen wäre das auch nicht anders zu erwarten, aber dennoch war ich mir dessen nicht sicher und entsprechend waren teilweise auch dann die Noten.
Vor und nach den Weihnachtsferien finden jeweils Themenwochen statt. Dabei handelt es sich entweder um Workshops, in denen man bastelt oder Neues lernt oder Seminare in Richtungen, in die sonst nicht unterrichtet wird. Klingt eigentlich spannend und ist – soweit die Aussage – als positiver Ausgleich für die Schüler gedacht. Vier dieser Wochen (je zwei in zwei Jahren) konnte ich miterleben und finde höchst spannend, wie sich hier ein besonderes Phänomen wiedergibt: Befragt man die Schüler offiziell, sind die Meinungen eigentlich meist positiv. Hört man den Schülern im persönlichen Gespräch hin und wieder zu, erfährt man aber: Mindestens die Hälfte, bis zwei Drittel der Schüler könnten auf solche Extra-Wochen auch verzichten. In über der Hälfte dieser Fälle liegt es zusätzlich an ermüdendem Inhalt, aber hauptsächlich einfach an der Tatsache, dass man erschöpft ist und lieber Ferien machen würde. Ich bin im Laufe der zwei Jahre immer wieder auf Situationen gestoßen, in denen sich die „öffentliche“ Meinung der Schüler von der tatsächlich geäußerten, privaten Meinung unterscheidet. Ich vermute, dass hier das tiefe Durchschnittsalter eine große Rolle spielt; Nein zu sagen ist eine Sozialkompetenz, die man erst aufwendig erlernen muss. Ich habe auch deutlich gesehen, dass vor allem ältere es waren, die ihre Empfindungen gegenüber der Schule ehrlich äußerten. Aber da gab es natürlich auf beiden Seiten auch Ausnahmen.
Endlich kommen dann die Ferien. Ich und meine Freundin dachten, wir könnten eine Woche in meiner Heimat ausruhen, und eine Woche in ihrer Heimat. Dabei haben wir uns mit einigen Freunden und der Familie getroffen, Weihnachten und Silvester gefeiert und kamen dann ziemlich erschöpft, aber pünktlich zum Unterrichtsstart wieder in der Schule an.
Klar war es mir schon vorher. Aber spätestens hier wurde deutlich, dass der soziale Kontakt niemals mehr so sein wird, wie er früher war. Einige Menschen aus dem Leben vor der Schule hatte man durch diese paar Monate bereits abgehängt und durch das Bewusstsein, dass man sich auch kaum noch persönlich treffen kann, musste ich dann meine Freunde und die Familie selektieren. Ein Wort, das unter Schülern öfter zu hören war, denn da ging es fast allen gleich. Aber es ist durchaus auch die beim Wort benannte Ansicht der Schulleitung, dass man sich im Kontakt zur Heimat zurücknimmt und dort neu startet und sich voll und ganz auf die Ausbildung und das dortige, gemeinschaftliche Leben konzentriert. Als ich das wahrgenommen habe ging mir erstmals das Licht auf, dass ich mich in dieser Schule in sektenähnlichen Gegebenheiten befinde. Allerdings war ich nach wie vor noch am Anfang meiner Ausbildung und hatte die Hoffnung, dass es noch besser werden könnte. Darum habe ich diesen Gedanken im Keim erstickt und bis heute, wo ich diese Zeilen schreibe, nie mehr gedacht.
Damit sich hier nicht weiter nur Absatz an Absatz reiht, berichte ich konkret von verschiedenen Erlebnissen und nicht mehr strikt nach einer Zeitlinie. Alle kommenden Erzählungen sind ein Spiegel der gesamten Zeit an dieser Schule und in der Regel nicht nur als Einzel-Situation wahrzunehmen – es sei denn, ich würde es ausdrücklich erwähnen.
Urteil und Verurteilung
Ein großer Pluspunkt der Schule ist eine nahe Beziehung zwischen Schülern und Mitarbeitern, bzw. Dozenten. So zumindest wird das stets kommuniziert. Ungeachtet meiner eigenen Erfolge zeichnet sich für mich ein anderes Bild. Generell von einer Beziehung zu sprechen spiegelt nicht wirklich die Wahrheit wider. Viel eher ist Beziehung eine Sache einzelner Dozenten, die sich dem annehmen wollen. Genauer muss ich natürlich auch sagen, dass alle Dozenten jederzeit – auch trotz vollem Terminplan – zum Gespräch bereit sind. Da einerseits ich davon hin und wieder Gebrauch gemacht habe und natürlich auch meine Mitschüler, konnte ich sehen, wie der Begriff „Beziehung“ im einzelnen zu verstehen ist.
In der Regel hört man den Schülern durchaus zu. Meine Erfahrung ist aber die, dass eher selten Taten folgen. Besonders betrifft das diejenigen Dozenten oder Mitarbeiter, die schon viele Jahre an der Schule tätig sind. Ein ganz anderes Bild zeichnete sich bei einem Dozenten, der im gleichen Jahr an dieser Schule angefangen hat, wie ich. Ein Dozent, der an der Beziehung zu den Schülern echtes Interesse und somit auch Spaß an dieser Beziehung hatte. Ähnlich, wie auch bei einem weiteren Dozenten, der etwa ein halbes Jahr später eingestellt wurde und viel im Gespräch mit den Schülern war. Hier konnte man sich unterstützen lassen, wenn es schief lief, oder man den Unterricht nicht gepackt hatte. In den jeweils von ihnen unterrichteten Fächern natürlich.
Nach etwa sechs Monaten mussten dann alle zu einem persönlichen Gespräch zwischen Einzelschüler und drei ausgewählten Dozenten. Dort spricht man darüber, wie man sich entwickelt hat und ob man sich verbessern könnte. Nicht nur in den schulischen Leistungen, sondern auch in Sachen Charakter und Persönlichkeit. Soweit ich mich erinnere, wurde ich nicht negativ beurteilt. Aber ich empfand das Unterfangen als durchaus seltsam, da ja jeder Mensch ein Recht auf seine eigene, selbstbestimmte Entwicklung hat. Sich dann ein bis zwei Mal einem Urteil von Dozenten zu unterziehen empfinde ich nicht unbedingt als angemessen. In aller Regel haben die Dozenten keinen Kontakt mit den Schülern, auch wenn die meisten von ihnen auf dem Schulgelände mit ihren Familien wohnen. Wie man sich dann ein Urteil über persönliche Eigenschaften bilden kann, ist mir ein Rätsel. Natürlich hat der eine oder andere Dozent und Schüler auch mal mehr Kontakt – das ist eine individuelle Sache. Es ist aber nunmal so, dass es hin und wieder solche Gespräche gab, mit denen die Schüler nicht gut zurecht kamen oder nach denen sie zumindest bestürzt waren. Angesprochen wurden etwa zurückhaltendes Verhalten oder ggf. mangelhafte schulische Leistung.
Die Spitze des Eisbergs ist dann aber ein General-Urteil im Kreis der ganzen Klasse gegen Ende der Ausbildung. Ich selbst habe es nicht erlebt, da ich früher abgebrochen habe. Ich war aber gezielt mit Menschen im persönlichen Gespräch, die mir gegenüber Bedenken zu diesem Anlass geäußert haben, oder von denen ich unsicher war, ob ein Feedback positiv ausfallen wird. Natürlich werden an diesem Anlass verschiedenste Themen besprochen und niemand muss durchwegs negative Worte über sich ergehen lassen. Aber niemand hat die Wahl, sondern es ist ein Muss. Problematische oder störende Angewohnheiten eines Menschen sind eine sehr sensible und vor allem private Angelegenheit, wegen derer man nicht öffentlich verurteilt werden dürfte. Natürlich sind das auch von Dozenten geführte Anlässe, aber junge Erwachsene (natürlich auch ältere) sind in der Regel noch nicht sensibel und wortgewandt genug, um wesentliche Kritikpunkte richtig wahrzunehmen und diese dann angemessen zu artikulieren. Die Wahrnehmung der Mitschüler ist zudem sehr verzerrt, was ein objektives Urteil über eine Persönlichkeit fast verunmöglicht. «Man kennt sich gut», wenn man so eng zusammen lebt – sagt man. Aber das stimmt nur begrenzt. Die Menschen kommen aus ihrer früheren Lebensrealität und werden nach Abschluss der Schule in eine neue Lebensrealität übergehen, die zu deren persönlichen Eigenschaften, Stärken und Schwächen passt. Die eigene Persönlichkeit eines Jeden passt sich automatisch den Gegebenheiten dieses schulischen Umfelds mit der engen gemeinschaftlichen Lebensweise an – bei manchen mehr, bei anderen weniger. Darum lernt kaum einer den anderen so kennen, wie er in der vergangenen oder zukünftigen, echten Lebensrealität war oder sein wird. Mit dem emotionalen Hammer immer wieder über Schüler zu urteilen ist darum mehr als unangebracht.
Aber auch ohne besondere Anlässe waren Urteile an der Tagesordnung. In einem Haus voller Christen erkennt man diese nicht unbedingt, wenn man nur zu Besuch vorbei kommt. Was manche Schüler, aber auch Mitarbeitende und Dozenten aber an Gedanken immer wieder ausgesprochen haben, war doch sehr bedenklich. Schließlich gab und gibt es ja auch Menschen, die dort unter Dauerstress- und Druck standen und es dennoch geschafft haben, freundlich zu sein. Besonders Lästereien lauern an jeder Ecke. Einerseits wird man verurteilt, ohne es zu wissen. Andererseits verurteilt man aber auch, ohne über Hintergründe zu kennen. Ich vermute (um nicht zu sagen „ich weiß“), dass ich auch davon betroffen war, da über fast jeden gelästert wurde. Aber mitbekommen habe ich das selten, bzw. bin in aller Regel reflektiert genug, um meine eigenen Fehler selbst wahrzunehmen. Ich habe also Lästerungen über mich praktisch nie wahrgenommen. Warum ich das sage? Ich schreibe diese Zeilen nicht, weil ich wegen Lästerungen über meine Person frustriert wäre. Das gilt eigentlich für diese gesamte Reihe von Berichten über diese Zeit an dieser Schule. Viel mehr bin ich immer wieder neu erschüttert über Zustände, die man mitten unter Christen antrifft. Dabei habe ich nicht nur die Erfahrungen an mir selbst erlebt, sondern auch gesehen, wie andere ungerecht behandelt werden und mich darüber mit einzelnen ausgetauscht.
Ich würde sagen, dass etwa ein Drittel aller Schüler nicht am Lästern teilgenommen hat. Es wäre daher durchaus auch möglich gewesen, Freundschaften aufzubauen. Immer wieder bin ich auf Menschen gestoßen, mit denen ich positive Momente erleben konnte. Manchmal auch mit Menschen, die gerne gelästert haben. Vermutlich lästert jeder irgendwann einmal. Aber besonders gut waren die Momente mit Menschen, bei denen ich den Eindruck hatte, dass sie ehrlich sind zu sich selbst und ihrem Umfeld.
Ich selbst hatte Schwierigkeiten, mit Wut umzugehen. Einerseits führte eine Krankheit zu immer wieder überfordernden Situationen, andererseits aber gab es auch keinen Raum für den Ausdruck negativer Emotionen. Dafür müsste man nach draußen gehen, da ein einzelner Schüler kaum Privatsphäre hat. Aber ungeachtet dessen muss man auch die Zeit haben, um sich eigenen Emotionen, Gefühlen und Gedanken widmen zu können. Für mich fiel das alles überwiegend weg. Um so mehr bin ich überrascht, wie wenig manche Schüler mit ihrer Wut umgehen konnten. Wut an sich war keine Seltenheit – da waren fast alle hin und wieder betroffen. Manche konnten aber besser und manche weniger gut damit umgehen. Was aber „umgehen“ bedeutet, wenn man gar nicht erst die Möglichkeit hat, damit umzugehen, weiß ich eigentlich auch nicht wirklich. Trotz aller Wut bin ich aber meistens freundlich mit den Menschen an der Schule umgegangen und habe an niemandem meine Wut ausgelassen. Darum ist es für mich schwierig zu verstehen, dass andere das nicht schaffen. Unglaublich oft – eigentlich jeden Tag – musste ich mitansehen, wie sich die Schüler mit ihrer Wut gegen die anderen Schüler gerichtet haben. Beschuldigen, anmotzen, schlechte Stimmung verbreiten. Gehört habe ich dann jeweils, dass ja gerade Prüfungsphase ist, dass gerade dies und jenes ansteht. Nun, so ist das nunmal, wenn man dort eine Ausbildung macht – irgendwas ist immer. Als Schüler ist man aber chancenlos, irgendetwas dagegen tun zu können. Entweder ist man notenstarker Schüler und kann seine Frustration ausgleichen, weil man die Zeit dazu hat, oder man ist stark genug, um es gegen sich selbst zu richten.
Ich für meinen Teil konnte das gegen mich selbst richten oder bei meiner Freundin zum Ausdruck bringen. Mit der Zeit steigerte sich dieses Maß an Selbstverletzung so stark, dass ich nachhaltig krank wurde.
Selbstverständliches arbeiten
«Die Studierenden, die machen das schon».
Ein Dozent.
Manchmal hört man Menschen Dinge sagen, und man weiß hinterher nie so ganz genau: «War das ein Scherz – bloß Ironie? Oder meint er/sie das ernst?». Und falls es doch ernst gemeint ist, weiß man dann außerdem auch nicht, ob sich die betreffende Person eigentlich bewusst ist, was sie gesagt hat.
Wie auch immer. Wie schon erwähnt, kommt es immer wieder zu außerordentlichen Anlässen und Festen, die von den Schülern ausgetragen werden. Im Namen der Schule und meist mit Worten des Direktors, um möglichst das «Gemeinsame» noch zu unterstreichen. Ein Paradebeispiel war ein Geburtstag eines älteren Theologen (zumindest nannte man ihn dort so), der eng mit der Schule zu tun und sie auch sehr geprägt hatte. Es war ein Ereignis, zu dem natürlich viele seiner Angehörigen, Freunde und andere Menschen eingeladen wurden. Ausgerichtet und vorbereitet haben die Schüler das Ganze. Dazu gehörte die Umgestaltung der öffentlich zugänglichen Räume der Schule, das Servieren der Mahlzeiten, Abwasch, die Koordination der Technik und allem, was dazu gehört. Etwa das Einstudieren eines Chor-Stücks und das abschließende Aufräumen. Besonders die Gesänge, die an Festen wohl üblich waren, wollte eigentlich nie jemand so richtig. Man sieht also: Es war schon eine sehr große Sache, auf die man sich da vorbereitet hatte. Bis zum Ereignistag wusste ich nicht, wer dieser Mensch eigentlich ist, für den wir hier einen Geburtstag ausrichteten. Vorgestellt hatte er sich uns dann auch nicht, daher wusste ich selbst einige Stunden während der Feier noch nicht einmal, wer unter all den Leuten eigentlich das Geburtstagskind ist. Einen Dozenten hätte ich natürlich fragen können. Aber wenn Du, lieber Leser, dir mal vorstellst, dass ich in Deinem Wohnzimmer einen Geburtstag für jemanden organisieren will und Dir auch noch die ganze Organisation übertragen würde, würdest Du vermutlich erwarten, dass ich Dir sage, um wen es eigentlich geht und warum Dein Aufwand gerechtfertigt ist.
Selbst heute weiß ich noch nicht abschließend, in wie fern das Geburtstagskind die Schule geprägt hat. Nur, dass die Schulleitung ein Fan von ihm ist.
Bis hierher wäre die Geschichte eigentlich schon Grund genug, um die Kapitelüberschrift zu rechtfertigen. Der eigentliche Hammer kam aber erst gegen Ende der Veranstaltung. Das Geburtstagskind hatte sich dann doch noch zu Wort gemeldet und sich reichlich bedankt. Beim Direktor und seinen Gästen. Ein Wort an die Bediensteten, die das Fest ausgerichtet hatten, fiel dann nicht mehr.
Gern geschehen.
Immerhin hatte der Direktor postwendend noch bemerkt, wer hier für die Organisation eigentlich zuständig war.
Beispiele wie dieses gibt es jeweils mehrere pro Jahr. Unser Pech war es vermutlich, dass gleich zwei Dozenten neu zu ihrer Stelle an der Schule begrüßt wurden und zwei die Schule verließen. Je ein Fest wert – selbstverständlich. Absurderweise muss man sagen, dass wenigstens zwei der Dozenten sich der Dankbarkeit und dem Respekt gegenüber den Schülern durchaus meistens bis immer bewusst waren. Da würde man für solche Menschen eigentlich noch so gerne ein Fest veranstalten. Genauso wie für Schüler, die die Ausbildung am Ende ihrer Zeit verlassen. Aber die Umstände lassen echte Freude dann nicht zu, oder sie geht in der ganzen Arbeit einfach unter.
Oft konnte man selbst entscheiden, in welchem Bereich an einem Fest man mitarbeiten will. Ich habe gelernt, mit welchen Aufgaben man am meisten atmen kann, während der Veranstaltung. Praktischerweise waren es auch die Aufgaben, in denen ich Kompetenzen mitgebracht habe. Es ist also daher alles in den entsprechenden Relationen zu sehen. Nicht alle waren mit den Festen unzufrieden, aber die meisten durchaus. Nur haben die meisten davon es nicht gewagt, sich zu Wort zu melden. Durch persönliche Gespräche, das Mithören verschiedener Lästereien und durch mein temporäres Amt als Klassensprecher konnte ich sehr viele verschiedene Meinungen und Kontexte aufsammeln.
Bei größeren Anlässen mit geladenen Gästen kippte die Selbstverständlichkeit oft in Respektlosigkeit über. Manche Schüler konnten mit dem Druck an solchen Veranstaltungen nicht gut umgehen und machten andere Schüler für Missgeschicke verantwortlich oder zögerten nicht, ihren Ärger an ihnen auszulassen. An konkreten Anweisungen fehlte es und die Schüler zögerten dann nachzufragen, weil sie die Konfrontation meiden wollten. Viele Tränen wurden deswegen vergossen. Nicht nur an Festen. Für mich ging das immer wieder zu weit, weswegen ich solche Arbeiten mit der Zeit gemieden und mich einmal auch der Weiterarbeit verweigert habe.
Überforderung trifft auf Unterforderung
Heute? Es war halt Dienstag. Die ersten zwei Stunden der Demütigung vom Montag waren schon seit 24 Stunden vergangen, und dann kamen heute die nächsten Zwei. Wie jeden Dienstag halt. Aber dieser Dienstag war etwas Besonderes: Diesmal durfte ich vor Überforderung sogar fast hyperventilieren.
Tagebuch, nach drei Monaten
Zu körperlichen Stress-Ausbrüchen ist es zum Glück nicht ganz so oft gekommen. Einerseits war dafür keine Zeit und später war es mir dann egal. Eine damalige Klassenkollegin sagte gerade aus zum Dozenten, als sie dem Unterricht nicht folgen konnte: «Es interessiert mich einfach nicht». Hätte ich zu diesem Zeitpunkt schon gewusst, dass ich das in gut einem Jahr auch so sehen werde, hätte ich bei dieser Ehrlichkeit einen Applaus eröffnet. Denn hinter diesem Satz war ebenfalls Resignation verborgen, aber niemand – nicht einmal ich selbst – hatte das nötige Einfühlungsvermögen, um das festzustellen.
So richtig verstanden habe ich die Stundenpläne nie. Im ersten Jahr wird man von Buch zu Buch, von Lernkarte zu Lernkarte gehetzt und wenn die Klasse zu langsam war, hat das der entsprechende Dozent stets gesagt – auch im zweiten Jahr. Das zweite Jahr jedoch ist dann plötzlich kein Stress mehr – im direkten Vergleich jedenfalls. Angemessenes Verteilen der Lernstoffe scheint wohl nie gelungen zu sein. Das hat sich auch innerhalb der Schulwochen immer wieder bemerkbar gemacht. Manche Fächer sind Powerfächer, in denen geballter Schulstoff dem Schüler um die Ohren fliegt und den er dann auch außerhalb des Unterrichts stark bearbeiten muss. Andere Fächer sind inhaltlich entweder völlig sinnlos, oder der Lernstoff wird derart in die Länge gezogen, das selbst interessante Themen an einem vorbeigehen. Natürlich wurde mindestens ein Dozent jetzt sagen: «Nach der Ausbildung! Da rufen sie dann immer an», weil man im Unterricht zu wenig aufpasst und dann im Beruf feststellt, dass die verpassten Themen doch eine Relevanz haben. Ich denke, dass ich diese Divergenz in vielen Fällen gut einschätzen konnte. Zumindest immer dort, wo ich bereits Erfahrung mitgebracht habe. Vermutlich hat gerade auch in diesem Bereich der Altersunterschied eine große Rolle gespielt, denn wir waren ja eher überdurchschnittlich alt mit knapp 30 Jahren.
Diese differenzierte Leistungsanforderung konnte man auch an verschiedenen Trends ablesen: Alle haben gemein, dass die Aufmerksamkeit dem eigentlichen Thema gegenüber teilweise völlig abwesend war. Manche befassten sich mit spaßigeren Themen, andere erledigten administrative Aufgaben, nochmals andere beschäftigten sich mit dem Lernstoff der Powerfächer.
Abgesehen von sehr gedehnten Abhandlungen diverser Fächer war aber auch die geprüfte Anforderungen zusätzlich kleiner, als bei den Powerfächern. Einige Fächer werden gar nicht geprüft. Andere nur teilweise.
Hier gäbe es viel Spielraum für Verbesserungen, denn das Curriculum, also der schulische Leistungsumfang der Schule ist randvoll. Laut Schulleitung muss das so sein, da sonst die Ausbildung nicht mehr so angesehen wäre. Den künftigen Arbeitgebern wird dadurch vermittelt, dass die Schüler entsprechendes lernen. Diesem Anspruch werden nach drei Jahren aber nur etwa die Hälfte genügen. Immerhin konnte ich dazu eine ehrliche Aussage eines Verantwortlichen entnehmen. Am Ende einer jeden Prüfung konnte man auf der einen Seite gut bestehen, wenn man nur auf die Interessen der Dozenten gezielt hat, anstelle, das Gelernte umfassend zu verstehen. Auf der anderen Seite konnte man aber auch knapp bestehen, ohne überhaupt etwas verstanden zu haben.
Hohe Ansprüche – aber nur an Schülern
Ich bin nicht sicher, ob es an hohen Leistungsansprüchen oder an jungem Lebensalter liegt, dass der Alkoholkonsum Dimensionen erreicht, mit denen ich mich nicht mehr wohlgefühlt habe. Parties ohne Alkohol gab es nicht. Nur unsere Klasse wagte es einmal, eine Party überwiegend ohne Alkohol durchzuführen. Ansonsten waren Trinkspiele und Literweise Alkohol allgegenwärtig. Sei es an Parties, oder auch bei privaten Treffen unter den Schülern.
Vielleicht grade weil viel junge Menschen in diese Ausbildung kommen, legt man Wert auf Reflexionen zum persönlichen Charakter. Wie es auch im Berufsleben läuft, wird man auch hier hin und wieder alleine mit Dozenten sprechen, um über die eigene Entwicklung oder eventuelle Missstände zu sprechen – seien es persönliche oder schulische. An sich ist das keine schlechte Idee. Manche Dozenten sind aber vom Geschehen der Schüler zu weit weg, sodass Urteile eigentlich nicht gerechtfertigt sind. Manche Gespräche haben eindeutig gezeigt, dass die Einschätzung der Dozenten nicht immer richtig sein muss. Und trotzdem scheint eine nicht kommunizierte Erziehungsrolle vom Haus der Schüler gegenüber zu existieren.
Im Kapitel «Urteil und Verurteilung» habe ich das ja näher ausgeführt. Selbstreflexion und persönliche Entwicklung sind klare, unmissverständliche Ansprüche an die Schüler. Umgekehrt können die Schüler aber kaum erwarten, dass die Dozenten reflektieren. «Was immer irgendwie funktioniert hat, wird bestimmt nicht geändert». So muss etwa die Grundeinstellung sein. Es gibt auch hier einige Ausnahmen. Im Großen und Ganzen sind Dozenten aber nicht bereit, ihre Unterrichtskonzepte zu reflektieren. Nicht einmal, wenn der Wandel der Zeit neue Erkenntnisse hervorbringt. Dies ist ganz besonders eines der Themen, mit denen nicht nur ich zu kämpfen hatte, sondern auch gut mithaltende Schüler. Es hatte aber sehr lange gedauert, bis wenigstens ein paar sich diesbezüglich zu Wort gemeldet hatten.
Leider sind einige Dozenten schon so lange in der Unterrichtspraxis, dass sie sich kaum noch auf die einzelnen Stunden vorbereiten. Schnell ist die Powerpoint-Präsentation und das Lesematerial aus früheren Jahren eingerichtet. Schade, denn in dynamischer Unterrichtsmethodik als auch in dynamischem Inhalt könnte man so viel bewirken.
Der hohe Anspruch fiel mir auch in anderen Bereichen immer wieder auf. Ohne christliches Vorwissen war die Schule kaum zu schaffen. Auch wenn man Prüfungen bestanden hat, hieß das noch lange nicht, dass man auch verstanden hat, worum es geht – wie bereits vorhin ewähnt. Dafür war ich manchmal ein Paradebeispiel, denn einige Prüfungen bestand ich gut, obwohl ich so gut wie nichts verstanden und damit auch nichts oder kaum etwas nachhaltig gelernt habe. Eine Kollegin sagte einst: «Du musst nur lernen und hinschreiben, was die Dozenten lesen wollen». Es trifft den Nagel auf den Kopf. Mit dem richtigen Geschick konnte man viel aus seinen Prüfungen herausholen, ohne das Geschriebene wirklich verstanden zu haben.
Doch nicht immer konnte man nicht-verstandenes einfach überspringen. Manche Dozenten sprechen selbstverständlich in völlig fremden Begriffen und Kontexten, die man auch sehr einfach hätte ausdrücken können. So soll man theologische Fachsprache lernen, die dann auch in Textform wiedergegeben werden muss, in der Praxis später aber nie zur Anwendung kommt. Dass Schüler dann deswegen nicht mehr mitkommen, obwohl sie das Themenfeld eigentlich verstehen würden, ist schon enttäuschend, aber leider unveränderbar in den Augen der Dozenten, die das so handhaben. Am Ende ist das Tempo der wichtigen Fächer so rasend schnell, dass man zu nicht verstandenen Wörtern oder Bereichen keine Fragen stellen kann oder teils auch nicht einmal die Zeit hat, sich das nicht verstandenen aufzuschreiben, damit man es gegebenenfalls später irgendwo nachlesen könnte. Ein echtes Studium habe ich selbst nie absolviert, aber mir wurde erzählt, dass diese Ausbildung wohl wesentlich mehr abverlangt als ein Studium. Am Ende bleibt dann aber lediglich ein schriftlicher Beweis, dass man die Schule besucht und nach Vorgaben des Curriculums bestanden hat. Einen staatlich anerkannten Abschluss hat von den Absolventen dadurch niemand. Angesehen ist die Schule in der Regel bei evangelischen Kirchen in Deutschland, teils auch in anderen Ländern.
Der Anspruch äußert sich auch in den schon erwähnten Feiern und anderen Tätigkeiten, in denen viel organisiert und erledigt werden muss. Im ersten Jahr wurde wegen fehlendem Personal die Schüler grundsätzlich nicht unterstützt, sondern mussten am Ende einfach ein Endergebnis zustande bringen. Danach, seit ein neuer Mitarbeiter eingestellt ist, werden sie zumindest angeleitet und delegiert.
Gemeinschaft und Dankbarkeit
Die intensive Gemeinschaft ist eines der Hauptargumente der Schule. Durch die vielen Veranstaltungen und das offensive Auftreten der Schule wird auch ein starkes Gemeinschaftsbild vermittelt. Das Bild zeigt Dozenten und Schüler gemeinsam an einer Ausbildungsstätte, wie sie gemeinsam durch die Zeit der Ausbildung gehen. Auf rein sachlicher Ebene ist der Satz so auch nicht falsch, immerhin leben die meisten Dozenten auch in unmittelbarer Nähe oder direkt auf dem Gelände. Dass die Bereitschaft für Gespräche aber während der Ausbildung kaum noch besteht, wurde von der Schulleitung auch so gesagt. Nur hört man das erst, wenn man als Schüler kritischen Gesprächsbedarf hat.
Einmal jährlich findet eine interne Veranstaltung statt, die den gesamten Abend füllt, an dem alle Schüler und Dozenten anwesend sind und die dem Gespräch zwischen den Menschen dienen soll. Wer genug Anhänger findet, kann sein Anliegen dann vortragen. Leider hat sich auch hier gezeigt, dass es sich weniger um einen Dialog handelt, als eher um eine weitere, nicht unbedingt notwendige Veranstaltung. Je kritischer die Anliegen werden, desto mehr halten sich die Dozenten zurück. Eine Veränderung zu bewirken ist damit sehr schwierig. Damit die Schüler trotzdem den Eindruck nicht verlieren können, selbst etwas bewegen zu können, werden manche Anliegen auch sehr ernst genommen. Aber eben eher nur dann, wenn es den Ansichten der Schulleitung nicht widerspricht.
«Gemeinschaft» bedeutet auch, dass andere soziale Kontakte leiden. Nicht nur die erwähnten Freunde und Familien. Beziehungen, die nicht direkt an der Schule stattfinden, weil man sich dort kennengelernt hat oder der Ehepartner ebenfalls dort wohnt, haben fast keine Chance. Die meisten werden scheitern und diejenigen, die dort entstanden sind ebenfalls, weil selten Paare aus derselben Klasse entstehen und damit die Fernbeziehung unumgänglich wird – und auch das Finden einer Stelle in derselben Region.
Vor Gott sind wir alle gleich, hieß es doch immer wieder. Ich vermute, die Dozenten glauben das tatsächlich. Und doch wurde eine Gesellschaft gelebt, die sehr stark in Klassen eingeteilt war. Die unterste und letzte Klasse bilden die Schüler. Darüber stehen alle früheren, bzw. bisherigen Absolventen der Schule. Noch eine Klasse höher stehen die Mitarbeitenden und Dozenten und darüber noch verschiedene Räte, die Entscheidungen treffen. Und dann kommt an fast oberster Stelle dann Jesus. Nur ein einziger bildet allein noch eine Klasse, und das ist derjenige, für den wir den Geburtstag ausgerichtet haben.
Nachdem ich nun über vieles geschrieben habe, ist «Dankbarkeit» natürlich nicht das vorherrschende Gefühl. Das war es während der Ausbildung, beim Abbruch und auch die vergangenen Wochen und Monate nicht. Und dennoch gibt es Gründe, dankbar sein zu können.
Etwa die Beziehung und Ehe mit Ramona, die durch all diese Ereignisse und Belastungen Eigenschaften erlangt hat, die ja vielleicht auch nicht alle Beziehung mitbringen. Obwohl die Bedingungen an der Schule gegen Beziehung stehen, konnten wir ein starkes Fundament bauen.
Wie schon erwähnt machten vor allem kurze Momente das Positive aus:
Ein kleines Highlight heute waren die 20 Minuten im Gemeinschaftsraum mit zwei Mitschülern.
Tagebuch
Nicht auf alle traf es zu, aber viele Schüler hatten für einfache und ernste Gespräche kaum Zeit. Ob guter Schüler, oder nicht: Terminieren musste man ein Treffen mit anderen auf jeden Fall – ohne ging das nicht. Manchmal traf man sich gezielt in einer Pause. Manchmal vor einem Gottesdienst. Einige sind Zweierschaften eingegangen; Ähnlich, wie ein Hauskreis, aber nur zu zweit. So zumindest hatte man sich ein wenig regelmäßige Verpflichtung einrichten können, auch mal mit anderen zu sprechen. Ausgiebiges Zeit verbringen, also in einem Rahmen von zwei bis drei Stunden, war nur sehr selten möglich. Bei den zwei oder drei Malen, an denen es mir dann doch gelungen ist, war aber immer der drückende Horizont im Hinterkopf, der an das Folgeprogramm oder die Schwindende Zeit des Lernens erinnerte. Darum waren es also eher die Randzeiten, die mir Freude gemacht haben.
Ich hatte außerdem Glück, dass eine Schülerin, mit der ich mich gut verstanden habe, sich lerntechnisch auf einem ähnlichen, etwas besserem Niveau befand, wie ich. So konnten wir uns einige Male vornehmen, zusammen zu lernen.
Besonders angetan hat es mir das Frühstück. Immer wieder hatte ich den Eindruck, die Menschen seien zu diesem Zeitpunkt aufgeschlossener oder weniger belastet. Auch wenn sie überwiegend natürlich noch müde waren. Vielleicht auch kein Wunder, denn auf dem Weg vom Zimmer zum Frühstück kann noch nicht so viel schief gehen. Das waren Momente, für die ich auch rückblickend noch dankbar bin und die in keinem anderen Umfeld so in dieser Regelmäßigkeit stattfinden würden. Mit etwas mehr von solchen sozialen Kontakten wäre die Zeit um ein vielfaches besser gewesen. Aber es war einfach nicht möglich. Die letzten Monate, die ich noch durchgehalten habe, führen allein darauf zurück, dass dort eine Hand voll Menschen gelebt hat, die mir gut getan hat – und nichts anderes. Zum Abschied habe ich diese Dankbarkeit den betroffenen Menschen zum Ausdruck gebracht. Ein wenig Dank oder zumindest Wertschätzung hätte ich mir auch von den Dozenten gewünscht. Zwei davon waren bereit, sich auf Augenhöhe zu verabschieden. Die anderen leider nicht. Die beginnende Corona-Krise war ein guter Grund, um die Verabschiedung auf dem Niveau «Tschüss» zu halten. Wobei uns beiden aber eigentlich genau dieselben Rechte zugestanden hätten, wie allen anderen, die mindestens ein Jahr diese Schule absolviert haben.
Mein Bild von Gott
Mit all diesen Erlebnissen hat sich mein Bild von Gott natürlich verändert. Augenscheinlich natürlich wegen der vielen und schwerwiegenden Vertrauensbrüche. Aber auch, weil eines meiner wenigen Ziele an der Schule war, Gott näher kennenzulernen. Nicht so, wie man das in der Gemeinde tut, sondern eben tiefgreifender. Vor allem konnte ich – ganz unabhängig von allen Ereignissen – vor der Schule nie richtig die Frage für mich beantworten, wer Gott eigentlich ist.
Da bin ich also wieder; zerstört, entmutigt, entkräftet.
Tagebuch
Gebete waren Mangelware, obwohl täglich viele Pflichtgebete anstanden. Etwa an Gottesdiensten oder beim Essen. Erst sehr spät wagte ich es, mich bei den beiden Pflichtgebeten vor und nach dem Mittagessen nicht an das allgemeine Augenschließen zu halten. Mit hohem Überraschungswert: Erst nach knapp eineinhalb Jahren stellte ich dadurch fest, dass gut ein Drittel aller Schüler nicht an Gebeten teilnahmen. Eine Weile lang habe ich das beobachtet. Diverse Gespräche zeigten leider auch, dass die Beziehung mit Gott stark leidet. Obwohl es auch in diesem Aspekt nicht allen so ging.
Viele Gebete – vermutlich die meisten – habe ich in ein Tagebuch geschrieben. Ungfähr ein dickes Notizbuch Buch habe ich während eineinhalb Jahren vollgeschrieben.
Vor der Ausbildung
Nun, ich war vor der Ausbildung immer der Meinung, dass man zumindest auf Gottes Unterstützung zählen darf, wenn man «zuerst nach dem Reich Gottes trachtet». Dass mir, wie es im Bibelvers heißt, alles zufällt, habe ich zu keinem Zeitpunkt je erwartet. Ich hatte also eher geringe Ansprüche an Gott. Also habe ich erst einmal nur getrachtet. Mein ganzes Leben – Familie, 80% des Besitzes, Freunde und einen gesicherten Lebensunterhalt habe ich aufgegeben, um in diese Ausbildung gehen zu können. Ich würde sagen, das wäre ausreichend «getrachtet» gewesen, um wenigstens die Ausbildung noch abschließen zu können.
Grundsätzlich habe ich mich immer als Realisten bezeichnet. Diese Grundeinstellung habe ich auch in meinen Glauben mitgenommen. Mir war also klar, dass mein Leben nicht immer so verlaufen kann, wie ich mir das wünsche. Das Gott nicht immer antworten wird, wie ich mir das vorstelle – oder gar nicht. Und dass meine Vorstellungen von einem positiven Ausgang eines negativen Ereignisses nicht immer dieselben sind, wie die von Gott. Ich habe aber stets geglaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist und er als Mittler zwischen Mensch und Gott zur Erde gekommen ist, da er die Menschen liebt und es gut mit ihnen meint. So etwas wie «Rache Gottes» hielt ich eher für unwahrscheinlich.
Ich war mir bewusst, dass es im Leben Prüfungen gibt. Dass der Mensch seinen Glauben unter Beweis stellen muss. Und ich hatte auch erwartet, dass die bevorstehende Ausbildung eine Prüfung werden wird.
Allerdings war ich mir sicher, dass man dabei nie verlassen wird, sondern immer darauf zählen kann, niemals «tiefer als in Gottes ausgebreitete Hände» fallen zu können, wie es so schön heißt.
Die Ausbildung
Tatsächlich wurde die Ausbildung zu einer Prüfung. Doch nicht nur in den Dimensionen, wie ich mir das im Vorfeld vorstellen konnte, sondern auch im Bezug auf meinen Glauben. Das hatte ich dann doch eher nicht erwartet. Und zwar einerseits deswegen nicht, weil ich eben doch alleine gelassen wurde. Den Begriff «Beziehung» definiere ich anders, als dass man sich mit mir in Verbindung setzt und ich antworte dann nach zwei bis drei Jahren, wenn ich sonst nichts besseres zu tun habe. So kann Gott aber nunmal auch sein. Andererseits hatte ich eine Glaubensprüfung dieser Art deswegen nicht erwartet, weil ich mir sicher war, dass ich an dieser evangelischen, theologischen Schule lernen würde, dass der Glaube auf Liebe und Vergebung aufbaut. Wann immer das in einen Predigttext passte, war das auch die allgemeine Meinung. Der gelebte Glaube war aber ein anderer.
Welch ein Skandal. Wir sitzen alle hier und sprechen aus, dass unsere Feinde vernichtet werden sollen. Mit welchem Recht sagen wir so etwas? Gott allein hat die Gerechtigkeit in seiner Hand. Nur er entscheidet, wer vernichtet wird, und wer nicht. Und wenn Gott jeden Mörder und Vergewaltiger in das Reich Gottes aufnimmt, dann ist das seine Entscheidung und seine Gnade und seine Liebe. Und wir alle haben nicht den Hauch eines Rechts, um seine Wege in Frage zu stellen.
Tagebuch
Natürlich ist es noch heute in Gottesdiensten völlig normal, dass man Psalmen betet. «Wir glauben nicht an die Bibel» meinte ein Dozent, doch wenn wir Wort für Wort beten, was in der Bibel steht, ohne darüber nachzudenken, ob das für uns heute noch stimmt, dann ist es genau das: Der Glaube an die Bibel. Ich war aber nicht bereit, meinen Feinden Feuer und Verderben zu wünschen und habe mich nach und nach aus solchen Gebeten ausgeschlossen. Leider waren sie auch teil regelmäßiger Liturgien, die schon alleine darum nicht infrage gestellt wurden, weil sie schon immer existierten.
Diesem widersprüchlichen Glauben bin ich oft begegnet: Je nach Unterrichtsfach hört man ein Statement, dem ein anderes Statement aus dem nächsten Fach widerspricht. Ganz zu schweigen von persönlichen Begegnungen mit Dozenten und Schülern, von denen ich ja schon genug geschrieben habe.
Ein besonderer Widerspruch lag in der evangelischen, hauptberuflichen Tätigkeit, die von den meisten Dozenten stets als eine höhere Gabe und Verantwortung angesehen wird. Eine Verantwortung kann ich zwar freilich nicht abstreiten, doch ein Ehrenamtlicher oder sonst jemand hat eine genauso große Verantwortung, wenn er mit anderen Menschen über den Glauben spricht. Diese Ansicht wird ganz klar von den Dozenten verneint. Auch hier wird die bereits erwähnte Klassengesellschaft um so deutlicher. Von Ehrenamt hält die Schulleitung überhaupt nichts. Zwar ist es wichtig, weil bestimmte Arbeiten schließlich erledigt sein müssen und die Kirche dafür nicht genug bezahlte Mitarbeiter einstellen kann, aber wehe, der Hauptamtliche passt nicht auf den Ehrenamtlichen auf.
Dieser Einstellung wollte ich meinen Glauben nicht anlehnen. Jeder noch so geringe Niemand wäre mit Gottes Hilfe in der Lage, die Welt zu verändern, ohne dass er dazu auch nur irgendeine Kompetenz mitbringen müsste.
Auch ist es meines Erachtens definitiv nicht im Ermessen des Menschen über die Berufung anderer Menschen zu urteilen. Diese ist es, die als Grundvoraussetzung zur Aufnahme an die Schule gilt. Über ein Dutzend Personen, die man teils auch in drei Jahren nicht ein einziges Mal je gesehen hat, beurteilen dann diese Berufung und stimmen entweder zu oder dagegen.
Am Ende habe ich die Ausbildung für mich zwar beendet, um nicht auch noch den restlichen Teil meines Persönlichkeit zu zerstören, aber am Ende habe ich auch bezüglich dem Glauben so gut wie nichts mitnehmen können. Was ich dort gelernt habe und vorgelebt bekommen habe wollte ich keiner Gemeinde der Welt weitervererben, in der ich dann wohlmöglich tätig geworden wäre.
Nach der Ausbildung
Heute, etwa eineinhalb Jahre später, halte ich mich nicht für etwas Besseres. Natürlich; ich habe die Ausbildung auch nicht abgeschlossen. Aber das meiste davon habe ich ja nun gesehen.
Trotz allem bin ich mir durchaus sicher, dass Jesus die einzige Wahrheit ist und bleibt. Nur weiß ich nicht, wie diese Wahrheit aussieht. Den liebenden Gott, der sich eine Beziehung wünscht, sehe ich in diesem Sinne nicht mehr, wie sich der Mensch «Beziehung» vorstellt. Liebe und Beziehung sind an Bedingungen geknüpft, die ich aber nicht definieren kann. Vor der Ausbildung war mir klar, dass die Liebe Gottes erstens nicht erklärbar ist und sie zweitens das menschlich vorstellbare weit übersteigt. Heute glaube ich, dass die Vorstellung der menschlichen Liebe barmherziger und großzügiger ist. Zumindest auf Zeitspannen menschlicher Vorstellung übertragen.
Ich habe keinen Zweifel, dass sich Gottes Liebe am Ende des menschlichen Lebens offenbaren wird. Das ist für meine Vorstellung von «Liebe» aber nicht unbedingt die allumfassende Antwort. Das bedeutet ja, dass Leid bewusst in Kauf genommen wird, weil Erlösung dann nach dem Tod kommen wird. Da bin ich schon froh, dass der Mensch (wenn auch lange nicht jeder) sich für den Ausdruck von Liebe nicht immer erst 80 bis 100 Jahre Zeit lässt.
Wir singen in den Gemeinden Lieder, in denen wir uns vollständig Gott zur Verfügung stellen. Dies zu tun kann aber einschneidende Veränderungen nach sich ziehen, die das Leben auch stark beeinträchtigen können. Die vollständige Zusage zur Nachfolge kann im schlimmsten Fall den Tod nach sich ziehen. Davon bin ich persönlich nicht betroffen, andere Menschen aber schon.
Denn Gottes Vorstellung von Gnade oder Liebe bezieht sich auf die Erlösung nach dem Tod und nicht auf das irdische Leben. Das ist mein derzeitiges Fazit zum Glauben.
Andere Menschen nach ihrem Grad an «Christsein» zu beurteilen halte ich persönlich für falsch. Meines Erachtens wurde das in dieser Schule gelehrt. Allerdings habe ich in meinem Leben auch Menschen kennengelernt, die lieben können und sich nicht als Christen bezeichnen. Ob diese Liebe etwas Wert ist, soll Gott beurteilen und nicht eine Schule. Für mich ist sie etwas Wert und für meine Kontakte ist auch das der ausschlaggebende Faktor, nach dem ich mich orientiere.
Amen.